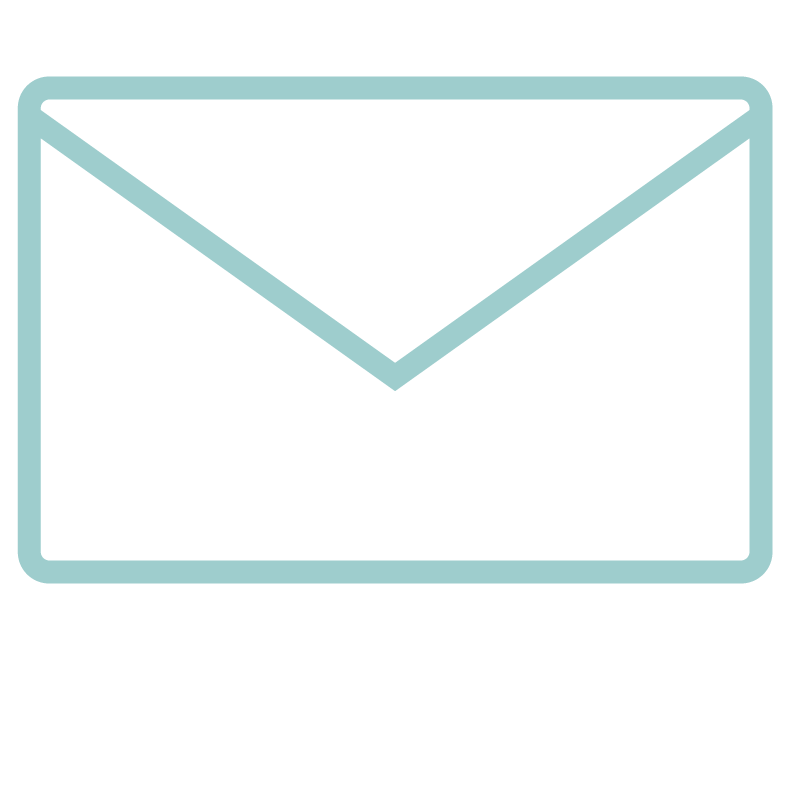Digitales Röntgen beim Zahnarzt: Vorteile und Sicherheit
- Autor: Dr. Maximilian Joeckel
Startseite » Ratgeber » Digitales Röntgen beim Zahnarzt: Vorteile und Sicherheit
Inhaltsverzeichnis
Digitales Röntgen vs. analoges Röntgen
Das digitale Röntgen, auch als Radiovisiographie bezeichnet, ist ein modernes Röntgenverfahren, das die Röntgentechnik mit elektronischer Datenverarbeitung kombiniert. Es unterscheidet sich vor allem in einem Punkt vom herkömmlichen Röntgen: dem Material, das für die Aufnahmen im Mund platziert wird. Während das analoge Verfahren mit Filmen arbeitet, kommen bei der digitalen Variante Sensorfolien oder kabelgebundene Sensoren und digitale Bildempfangssysteme zum Einsatz.
Die Vorteile digitaler Röntgenaufnahmen
Diese Vorteile bietet das Röntgen der digitalen Art:
- Geringere Strahlendosis: Dank der höheren Sensitivität der Bildempfangssysteme reduziert sich die Menge an Strahlen, denen der Patient ausgesetzt ist
- Panoramaschichtaufnahmen: Neben 2D-Einzelbildern können Panoramaschichtaufnahmen angefertigt werden, die sowohl die Zähne als auch umliegende Strukturen im Mund (z.B. Kieferhöhlen und Kiefergelenke) abbilden
- Verfügbarkeit der Aufnahmen: Anders als Filme, die entwickelt werden müssen, stehen die digitalen Bilder sofort nach der Aufnahme zur Verfügung, was Wartezeiten abbaut und eine schnellere Diagnostik ermöglicht
- Bearbeitung und Qualität der Bilder: Die digitalen Aufnahmen können problemlos nachbearbeitet werden, um beispielsweise Überbelichtungen auszugleichen, Kontraste zu optimieren und Details zu vergrößern, sodass das Bild präzisere Informationen zur Beurteilung liefert
- Speicherung, Archivierung und Verwaltung: Oft wird die Röntgentechnik in die EDV der Zahnarztpraxis eingebunden, was ein unkompliziertes Speichern, Archivieren und Verwalten der Röntgenaufnahmen zum effizienten Standard macht
Indikation: Wann werden Röntgenaufnahmen in der Zahnmedizin benötigt?
In der Zahnmedizin dienen Röntgenaufnahmen mitunter diesen Zwecken:
Beurteilung von Zahnzwischenraumkaries
Diagnose von Karies an Zahnersatz und Füllungen
Erhebung des Zahnstatus im Vorfeld weiterführender Behandlungen (z.B. Extraktion von Zähnen)
Begutachtung des Zahnhalteapparats
Wurzelkanalbehandlungen und Wurzelspitzenresektionen
Einschätzung von Zahnfrakturen
Zahnwechselverlaufskontrolle
Erfolgs- und Verlaufskontrolle nach Behandlungen
Überwachung der Heilung nach Eingriffen
Planung von Implantationen
Ablauf der digitalen Röntgenuntersuchung
Bei einem Termin zur Anfertigung digitaler Röntgenaufnahmen in Zahnarztpraxen durchlaufen Patienten diese Schritte:
Vorgespräch: Vor der Untersuchung klärt der Zahnarzt den Patienten über Grund, Nutzen und Risiko der Untersuchung auf und erfragt einige relevante Informationen (z.B. zu potenziell bestehenden Schwangerschaften oder in jüngerer Vergangenheit angefertigten Röntgenaufnahmen).
Vorbereitung: Der Patient wird gebeten, sämtlichen Schmuck abzulegen und eine Bleischürze sowie gegebenenfalls Schutzweste und -schild zum Schutz vor Strahlung anzuziehen.
Platzierung und Einweisung: Dann gilt es, eine Position einzunehmen, in der die Aufnahmen in möglichst hoher Qualität gemacht werden können. Der Patient wird hierfür vom Personal exakt platziert und angewiesen, sich für die kurze Dauer der Aufzeichnung nicht zu bewegen.
Technik: Schließlich wird der kabelgebundene Sensor oder die Sensor-Speicherfolie an den Bereichen, die geröntgt werden sollen, platziert.
Röntgen: Dann beginnt das eigentliche Röntgen. Das Personal verlässt hierfür den Raum und startet den Vorgang, der nur wenige Sekunden in Anspruch nimmt.
Nachbereitung: Sobald das Bild im Kasten ist, wird der Patient von dem Sensor beziehungsweise der Speicherfolie befreit, darf die Schutzkleidung ausziehen und seinen Schmuck wieder anlegen.
Besprechung: Beim digitalen Röntgen stehen die Röntgenbilder sofort zur Beurteilung zur Verfügung. Häufig findet daher direkt ein Gespräch mit dem Zahnarzt statt, der die bildliche Darstellung mit dem Patienten bespricht und anhand der neu gewonnen Informationen eine Diagnose stellen oder weiterführende Maßnahmen zur genaueren Diagnostik ergreifen kann.
Funktionsweise: Die Technik hinter dem digitalen Röntgen
Das Röntgen gehört zu den Methoden, die in der Medizin schon lange angewandt werden, deren Funktionsweise aber dennoch längst nicht jedem bekannt ist. Das Grundprinzip ist recht simpel: Mit einem Röntgengerät werden Röntgenstrahlen auf einen bestimmten Bereich des Körpers – beispielsweise Kiefer und Zähne – gerichtet.
Die Strahlen, die in der sogenannten Röntgenröhre entstehen, werden von den Strukturen des Körpers in verschieden hohem Maße absorbiert. Gewebearten mit hoher Dichte, allem voran knöcherne Strukturen, erscheinen dadurch heller als durchlässigeres Körpergewebe, zum Beispiel Bindegewebe und Muskulatur. Nachdem die Strahlen den Körper passiert haben, landen sie auf einem Detektor, auf dem letztlich die kontrastreichen Röntgenbilder entstehen.
Nach diesem Prinzip funktioniert sowohl das digitale Röntgen als auch die analoge Methode, mit dem Unterschied, dass zur Anfertigung digitaler Röntgenaufnahmen weniger starke Röntgenstrahlung benötigt wird. Diese Reduktion der Strahlenbelastung wird durch die modernen Sensoren und Sensorfolien ermöglicht, die deutlich empfindlicher auf die Strahlen reagieren, als es bei herkömmlichen Röntgenfilmen der Fall ist.
Sicherheit und Röntgenstrahlung: Wie hoch ist die Strahlenbelastung beim digitalen Röntgen?
Es ist allgemeinhin bekannt, dass die Strahlung, der der Körper beim Röntgen ausgesetzt ist, potenziell Zellveränderungen hervorrufen und so unter anderem das Krebsrisiko erhöhen kann. Deshalb wird in der Zahnmedizin – genau wie in jedem anderen medizinischen Bereich – penibel darauf geachtet, keine unnötigen Röntgenbilder anzufertigen und die Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten. Zähne, Kieferhöhlen und Kiefergelenke werden also nur dann geröntgt, wenn die bildliche Aufzeichnung unbedingt benötigt wird, etwa um zahngesundheitliche Probleme einschätzen, eine Diagnose stellen oder die ideale Behandlungsmethode auswählen zu können.
Auch wenn nicht von der Hand zu weisen ist, dass das Röntgen mit einem gewissen Risiko verbunden ist, gibt es jedoch keinen Anlass, angesichts eines anstehenden Röntgentermins in Panik zu verfallen. Schließlich werden die meisten Menschen nur zu seltenen Gelegenheiten geröntgt, sodass der Nutzen der Aufnahme das Risiko, das der Kontakt mit der Strahlung mit sich bringt, bei Weitem überwiegt.
Zur Veranschaulichung: Viele Experten stimmen darin überein, dass Erwachsene pro Jahr maximal 1.000 µSv (Mikrosievert) Strahlung ausgesetzt werden sollten. Wird ein Röntgenbild von einem Zahn nach analoger Methode gemacht, entspricht das ungefähr 5 µSv, beim digitalen Röntgen liegt der Wert nochmals deutlich niedriger. Wer eine zehnstündige Reise mit dem Flugzeug unternimmt, setzt sich hierbei einer erheblich höheren Strahlenbelastung aus, nämlich etwa 25 µSv. Diese Beispiele verdeutlichen, warum es so wichtig ist, die Gefahr von Röntgenstrahlen zwar angemessen ernst zu nehmen, aber auch in ein realistisches Verhältnis zu setzen.
Fazit: Die Rolle des digitalen Röntgens in der Zahnmedizin
Ob zur Überprüfung des Heilungsprozesses nach einem Eingriff, zur Diagnostik von Erkrankungen an Zähnen und Zahnhalteapparat oder zur Planung von Implantationen: Das Röntgen ist ein Verfahren, das im Arbeitsalltag eines jeden Zahnarztes einen festen Platz einnimmt. Dabei können die Röntgenaufnahmen heutzutage dank moderner, digitaler Röntgentechnik in bester Qualität und mit vergleichsweise niedriger Strahlenbelastung angefertigt werden – ein großes Plus für die Zahngesundheit.
FAQ – Häufige Fragen zum digitalen Röntgen in der Zahnarztpraxis
Hat das digitale Röntgen auch Nachteile?
Das Bildgebungsverfahren des digitalen Röntgens weist einige Nachteile auf. Allem voran sind hier mögliche technische Probleme zu nennen, da die Röntgenmethode EDV-gebunden ist. Zudem nehmen manche Patienten das Tragen der Sensoren mit Kabeln als unangenehm wahr. Im Gesamtbild dürften die Vorteile des digitalen Röntgens (z.B. weniger Strahlung, sofortiger Zugriff auf die Bilder und höhere Bildqualität durch Nachbearbeitung) jedoch ganz klar überwiegen.
Übernimmt die Krankenkasse die Kosten für digitale Röntgenbilder?
Ja, gesetzliche und private Krankenkassen tragen in aller Regel die Kosten für das digitale Röntgen der Zähne und des Kiefers.
Wie lange dauert das Röntgen der Zähne?
Das Erstellen von Röntgenbildern dauert wenige Sekunden und nur Augenblicke später können die Aufnahmen begutachtet werden. Allerdings sollten Patienten etwas Zeit für die Vor- und Nachbereitung (Ablegen von Schmuck, Platzieren der Sensoren, Gespräch mit dem Zahnarzt etc.) beim Röntgentermin einplanen.
Welche Schutzmaßnahmen sind beim Röntgen aufgrund der Strahlung zu treffen?
Zum Schutz vor den Röntgenstrahlen tragen Patienten spezielle Schutzausrüstung. Gängig sind unter anderem Schutzschürzen, -westen und -schilder.
Eignet sich das digitale Röntgen der Zähne auch bei Kindern?
Ja, auch bei Kindern können digitale Röntgenaufnahmen der Zähne erstellt werden.
Wann dürfen keine Röntgenaufnahmen angefertigt werden?
Schwangeren ist vom Röntgen abzuraten. In Ausnahmefällen, in denen eine Röntgenuntersuchung absolut unverzichtbar ist, wird zumeist auf zusätzliche Schutzkleidung zurückgegriffen.

Autor:
Dr. Maximilian Dörfler
Dr. Dörfler ist im Bamberger Sandgebiet aufgewachsen, hat sein Zahnmedizinstudium in Regensburg absolviert und anschließend an verschiedenen Orten, darunter auch im Universitätsklinikum Regensburg, gearbeitet. Nach einer prägenden Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllt er nun seinen Traum mit der Eröffnung der Praxis "Mundhandwerk", in der er modernste Zahnmedizin in angenehmer Atmosphäre anbietet, insbesondere im Bereich Implantologie und Knochenaufbau.